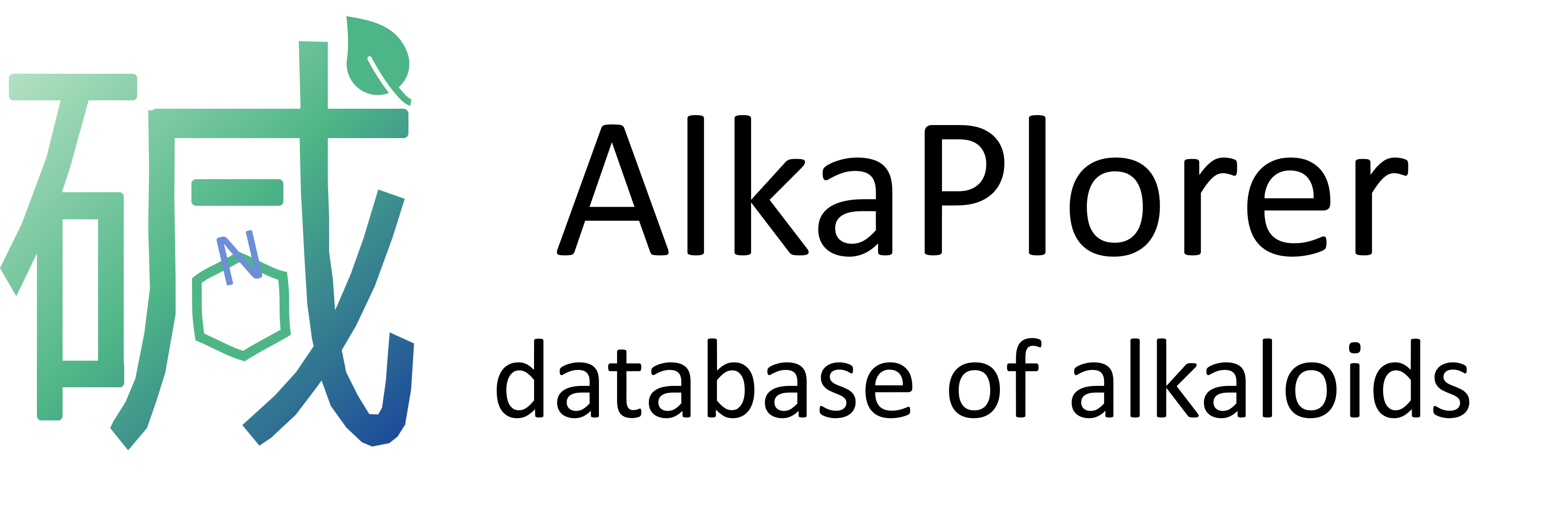
terraums (unterschiedliche Vorzeichenkombinationen von J₁ und J₂, Startwerten usw.) zeigte, dass drei Parametersätze vernünftige Ergebnisse liefern. In der Anordnung J₁, J₂, g sind dies: -367 cm⁻¹, -94,7 cm⁻¹, 2,14; 7,4 cm⁻¹, -3,6 cm⁻¹, 1,86; -26,8 cm⁻¹, 12,1 cm⁻¹, 1,86. Die Standardabweichungen bei diesen Parametern wurden zu 5 % geschätzt. Diese drei Lösungen weichen nicht nur von der des alten Modells beträchtlich ab (großes negatives J₁, S=3/2-Grundzustand mit nahem angeregtem S=1/2-Zustand), sie unterscheiden sich auch untereinander stark. Die erste ergibt einen S=7/2-Grundzustand mit einem nur 9 cm⁻¹ energiereicheren angeregten S=9/2-Zustand. Die zweite Lösung weist einen S=9/2-Grundzustand und einen angeregten S=7/2-Zustand auf, getrennt durch nur 0,5 cm⁻¹, sowie sieben weitere Spinzustände innerhalb von 50 cm⁻¹ vom Grundzustand. Dagegen hat die dritte Lösung einen S=9/2-Grundzustand mit dem nächsten angeregten Zustand (S=7/2) 226 cm⁻¹ über dem Grundzustand. Die dritte Lösung wurde für die Berechnung der durchgezogenen Kurve in Abbildung 2a verwendet. Zu unserer Überraschung folgte aus den Daten der Magnetisierung von 2, erhalten über einen Temperaturbereich von 1,8 bis 40 K bei Feldstärken von 2,5 bis 4,5 T, eindeutig ein isolierter S=9/2-Grundzustand (Abb. 2b). Dies ist in Einklang mit dem dritten Satz von Parametern, der aus den Suszeptibilitätsdaten gewonnen wurde. Die Annahme eines isolierten S=9/2-Niveaus als Grundzustand wird dadurch gestützt, dass trotz einiger Veränderungen und einem Verlust an Auflösung bei höherer Temperatur das EPR-Spektrum von 2 (Pulver oder Glas) sowohl bei der Temperatur von flüssigem Helium als auch bei der von flüssigem Stickstoff leicht erhalten wird. Dieses Verhalten wäre für die Vielfalt von Spinzuständen des zweiten Parametersatzes nicht zu erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass alle Merkmale des EPR-Spektrums von 2 (Glas) bei g=2, 6 und 9 (ähnlich denen von Übergängen zwischen den Komponenten des S=9/2-Grundzustands) zuzuschreiben sind, der, wie eine genaue Analyse der Auftragung von M gegen H/T (Abb. 2b) zeigt, eine axiale Nullfeld-Aufspaltung mit D=0,25–0,35 cm⁻¹ erfährt. Ob der S₂-Zustand von PS II einen Cluster analog dem von 2 enthält, ist noch unklar, aber die vorliegende Arbeit zeigt, dass ein Grundzustand mit großer Spinquantenzahl als Erklärung für die EPR-spektroskopischen Eigenschaften des S₂-Zustands ernstlich in Betracht gezogen werden sollte. Vor kurzem erst konnten wir einen dinuclearen Mnᴵᴵ-Mnᴵᴵᴵ-Komplex charakterisieren, der ebenfalls ferromagnetisch gekoppelt ist und einen S=9/2-Grundzustand hat (verifiziert durch Auftragung von M gegen H/T). Das EPR-Spektrum dieses Mnᴵᴵ-Mnᴵᴵᴵ-Komplexes ähnelt denen von 1 und 2; Kürzlich isolieren wir aus Kulturen des Bakterienstamms Bacillus subtilis ATCC 6633 neue Di- und Tripeptide (Rhizocticine A-D). Diese phosphonohaltigen Wirkstoffe zeigten unter anderem fungizide Eigenschaften. Dies war Anlass für eine systematische Suche nach neuen hydrophilen antifungischen Antibiotica aus der Gattung Bacillus. Eine im Kulturfiltrat von B. subtilis BGSC 1E2 gefundene antifungische Aktivität ließ sich durch Di- und Tripeptide kompetitiv antagonisieren. Zur Isolierung des Wirkstoffs aus der Kulturbrühe (nach 84 h Fermentation bei 27 °C, komplexes Medium) wurden Methoden angewendet, die für hydrophile mikrobielle Metabolite geeignet sind. So wurde nach alkoholischer Proteinfällung und Anreicherung durch Adsorption an Aktivkohle eine gelchromatographische Reinigung (CM-Sephadex C-25, Sephadex G-10) durchgeführt. Die Feinreinigung des Antibiotikums erfolgte an Cellulose (Ausbeute 5 mg pro Liter Kulturfiltrat). Diese amphotere Verbindung konnte als Chlorotetain 1 [(S)-Alanyl-(S)-3-[(R)-3'-chlor-4'-oxo-2'-cyclohexenyl]alanin (Ala-CCAla)] mit der neuartigen chlorhaltigen Aminosäure CCAla identifiziert werden. Die Aminosäurebestimmung ergab als Bestandteile L-Alanin und L-Tyrosin. Sie wurde folgendermaßen durchgeführt: Das saure Totalhydrolysat (6 N HCl, 18 h, 110 °C) wurde nach Veresterung mit n-Propanol und Acetylierung mit Trifluoressigsäureanhydrid (Tfa) gaschromatographisch an Chirasil-Val analysiert. Das FD-Massenspektrum von 1 zeigt einen [M+H]⁺-Peak bei m/z 289, begleitet von einem Isotopenpeak bei m/z 291 (Tabelle 1). Aus dieser Massendifferenz von 2 und dem Fragment-Ion bei m/z 253 ([M-Cl]⁺) ergab sich die Anwesenheit von Chlor in 1. UV- und NMR-Spektren zeigten, dass L-Tyrosin kein natürlicher Baustein von 1, sondern nur das Abbauprodukt der säurelabilen C-terminalen Aminosäure ist. Die GC-MS-Analyse (Kapillarquarzsäule SE 52) des N-Tfa-dipeptidmethylesters ergab als Peak höchster Masse (m/z 363) nur den für [M-Cl]⁺. Die Fragment-Ionen bei m/z 140 und 141 sind typisch für N-terminales Alanin, dessen Anwesenheit durch Dinitrophenylierung bestätigt wurde. Zur Erklärung der Tyrosinbildung war ein sechsgliedriges Ringsystem mit definierter 1,4-Stellung von Peptidylrest und Ketofunktion erforderlich. Die 3-Stellung des Chlorsubstituenten im 2-Cyclohexenonsystem ergab sich aus den NMR-chemischen Verschiebungen des olefinischen Protons (δ=7,3) und des zugehörigen C-Atoms (δ=156,3). Die C-terminale Aminosäure enthält in ihrer Seitenkette den Cyclohexenon-Chromophor mit einem asymmetrischen C-Atom in 1'-Stellung. Da aus sterischen Gründen nur die äquatoriale Stellung des Peptidylrests in Betracht kommt, ist für die beiden möglichen Diastereomere nur je eine Halbsesselkonformation denkbar; dabei ist die 6'-CH₂-Gruppe nach unten [(R)-Konfiguration an C-1'] bzw. nach oben [(S)-Konfiguration] aus der Ebene herausgedreht. Die Konfiguration am C-1'-Atom erhielten wir durch Messung des Circulardichroismus (Tabelle 1). Für das annähernd planare Cyclohexenonsystem gilt wie bei α,β-Epoxy- und α,β-Cyclopropylketonen die inverse Oktantenregel. Danach setzt die Beobachtung eines negativen n,π*-Cotton-Effekts, der hier auf den negativen Beitrag der 6'-CH₂-Gruppe zurückzuführen ist, eine (R)-Konfiguration voraus. Chlorotetain 1 ist in wässriger Lösung bei pH 5 und Raumtemperatur stabil. Sowohl im stärker sauren als auch im alkalischen Milieu nimmt insbesondere beim Erwärmen die biologische Aktivität rasch ab. Von Amino- und Amidoenonen ist bekannt, dass sie leicht eine 1,4-Addition zu 6-Oxo-octahydroindolen eingehen. Eine ähnliche Reaktivität dürfte für die Instabilität von 1 mitverantwortlich sein. 1 hemmt verschiedene Pilze, in hoher Konzentration auch Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Besonders empfindliche Pilze (MIC < 1 µg) sind Aspergillus fumigatus, Candida albicans und Paecilomyces variotii. 1 ist das erste chlorhaltige Peptid, das als Metabolit von B. subtilis isoliert wurde. Andere chlorhaltige Aminosäuren und Peptide sind als Metabolite von Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Schwämmen bekannt. Der Bakterienstamm produzierte eine weitere antibiotische Substanz, die als das zu 1 strukturell verwandte Tetain (Bacilysin) [(S)-Alanyl-(S)-3-[(R)-2',3'-epoxy-4'-oxo-cyclohexyl]alanin 2] identifiziert wurde. Der C-Terminus, der auch als Anticapsin isoliert wurde, hemmt nach intrazellulärer Hydrolyse des Dipeptids irreversibel die Glucosamin-6-phosphat-Synthetase von Bakterien und Hefen. Da 1 und 2 strukturell ähnlich sind, ist es prinzipiell denkbar, dass 1 während der Isolierung aus 2 entsteht. Die bereits vor der Isolierung mögliche Korrelation von biologischer Wirkung und HPLC-Nachweis durch UV-Detektion widerlegt diesen Verdacht. Wir konnten zeigen, dass Bacilysin 2 bei Bacillus subtilis und verwandten Arten relativ häufig auftritt. Dagegen wurde Chlorotetain 1 nur in Kulturen des ebenfalls Bacilysin-bildenden Stammes B. subtilis BGSC 1E2 gefunden. Dies sind der durch eine Plasmidübertragung aus B. subtilis 168 hergestellte, zur Produktion von 1 benutzte Stamm und der zugehörige Plasmidspender. Somit liegt mit 1 ein neuer chlorhaltiger Sekundärmetabolit vor, der wie 2 und andere Oligopeptide über das Dipeptidtransportsystem in die Bakterienzelle eindringen kann. Die nach saurer Totalhydrolyse bei CCAla gefundene Aromatisierung zeigen auch andere Peptidantibiotika mit labilem Sechsringalicyclus. So entsteht durch Aromatisierung aus dem 4-Aminocyclohexadienylsystem der Amiclenomycinpeptide unter Ammoniakabspaltung L-Homophenylalanin und aus dem epoxidhaltigen Sechsring von 2 ebenfalls L-Tyrosin. Aufgrund dieser Stabilisierungstendenz sind die Ringsysteme von 1 und 2 durch chemische Synthese nur schwer zugänglich