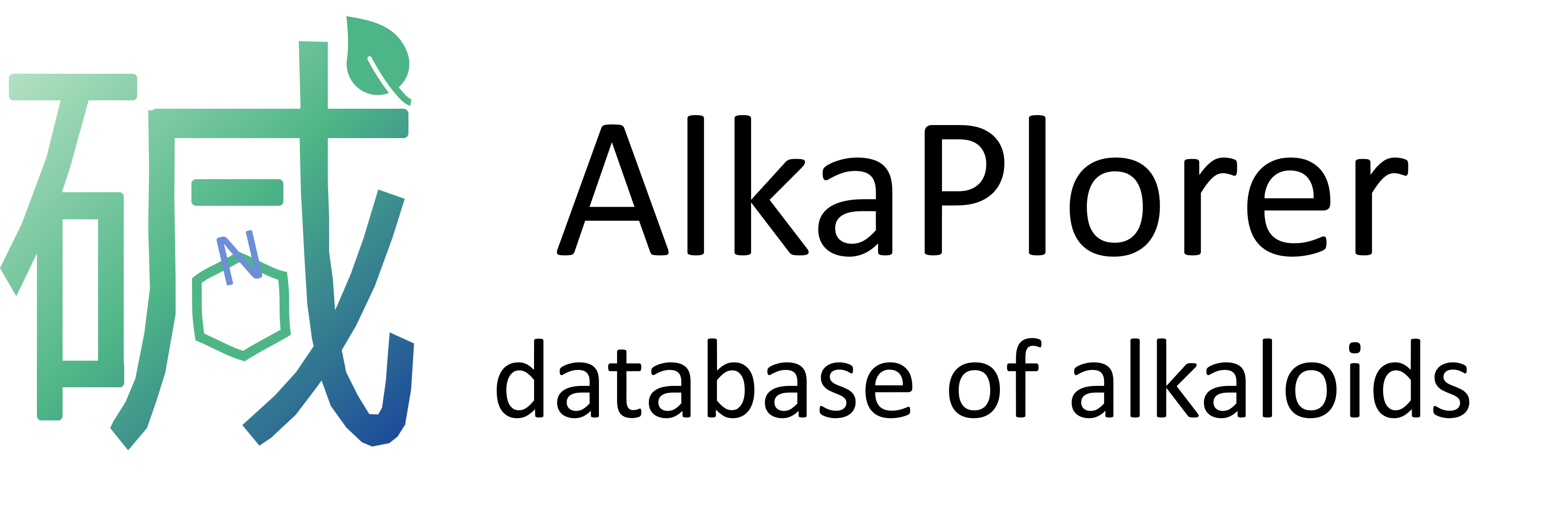
Im komplizierten Entwicklungscyclus der Schleimpilze spielt Licht eine wichtige Rolle. Man hat daher schon oft versucht, Substanzen aus den Plasmodien zu isolieren, die als Photorezeptoren in Frage kommen. So wurde vermutet, daß die gelben Farbstoffe Flavine, Flavone, Polyene, Pteridine oder phenolische Verbindungen sind. Im folgenden wird gezeigt, daß die gelbe Farbe der Plasmodien von Fuligo septica auf Tetramsäuren mit Polyenchromophor beruht. Methanolextrakte der Plasmodien oder Aethalien sind hellgelb und verfarben sich beim Ansauern mit Salzsäure orange. Offensichtlich liegt ein großer Teil der Farbstoffe in Form von Salzen vor, aus denen beim Ansauern die freien Pigmente erhalten werden. Einengen der Methanollösung und Verteilen des Rückstands zwischen Essigester und Wasser liefert eine organische Phase, die nach dem Entfernen des Solvens und Digerieren mit n-Hexan ein rotes Pulver ergibt, das nach dem Dunnschichtchromatogramm neben zwei Hauptfarbstoffen und etlichen Nebenpigmenten größtenteils aus farblosen Komponenten besteht. Das Gemisch läßt sich durch Chromatographie an Sephadex-LH-20 mit Methanol trennen; dabei muß unter Lichtausschluß und mit gekühlten Säulen gearbeitet werden. Nach Rechromatographie an Sephadex-LH-20 (Eluent: Aceton/Methanol 4/1) erhält man einen der beiden Hauptfarbstoffe, Fuligorubin A, rein. Für Fuligorubin A ergibt sich aus dem Massenspektrum die Summenformel C₂₀H₂₇NOS, und die Fragmente C₁₂H₁₂O, C₁₁H₁₃ sowie C₈H₁₀NOS deuten auf die Verknüpfung einer Polyeneinheit C₁₁H₁₃CO mit einem stickstoffhaltigen Rest C₈H₁₀NO hin. Das UV-Spektrum (MeOH) zeigt Absorptionsmaxima bei λ = 243 und 425 nm. Gibt man Natronlauge zu, verschiebt sich die langwellige Absorption hypsochrom nach λ= 377 nm, und ein Farbumschlag von orange nach zitronengelb tritt ein. Im ¹H-NMR-Spektrum ([D₆]Aceton) sind Signale für eine all-trans-2,4,6,8,10-Undecapentaen-Kette und ein Strukturelement -CH₂CH₂NH(CH₃)- vorhanden, die sich durch ein 2D-H-H-COSY-(90°)-NMR-Experiment zuordnen lassen. Zwei weitere Protonen sind bei einer Tieftemperaturmessung (T= 180 K) bei δ=11.85 und 14.10 zu erkennen. Das ¹³C-NMR-Spektrum bestätigt die beiden Partialstrukturen; die fünf zusätzlichen Signale können einer Carboxygruppe (δ = 172.3), einer Säureamidgruppe (δ = 174.1) und einer Gruppierung -C(OH)=C-CO-, an die über die Carbonylgruppe der Polyenrest geknüpft sein muß, zugeordnet werden. Berücksichtigt man die Ergebnisse von selektiv ¹H-entkoppelten ¹³C-NMR-Spektren, ergibt sich für Fuligorubin A die Struktur 1. Die spektroskopischen Daten sind in Einklang mit denen anderer Tetramsäuren, für die auch die hypsochrome Verschiebung der langwelligen Absorption bei Laugenzusatz charakteristisch ist. Zur Bestimmung der absoluten Konfiguration wurden Decahydrofuligorubin A 2 und das aus L-Glutamin synthetisierte Tetramsäure-Derivat 3 in ihren chiroptischen Eigenschaften verglichen. Da die Circulardichroismus(CD)-Kurven spiegelbildlich verlaufen, muß Fuligorubin A S,R-konfiguriert sein. Die Isolierung eines Tetramsäure-Derivats aus Fuligo septica ist bemerkenswert, da Verbindungen dieses Typs als Mycotoxine, Antibiotica und Tumorstatica bekannt sind. Ob die Fähigkeit von 1, mit Magnesium- und Calcium-Ionen Chelate zu bilden, für den Stoffwechsel von Fuligo eine Rolle spielt, muß noch untersucht werden. Retinalproteine, die Retinal als protonierte Schiffsche Base enthalten (1 in Schema 1), absorbieren sichtbares Licht. Einerseits werden hierdurch sensorische Prozesse ausgelost, z.B. durch die Rhodopsine in Vertebraten der Sehvorgang und durch Membranproteine von Halobacterium halobium photophobische/photoattraktive Reaktionen. Andererseits findet Energieumwandlung statt, die in Bacteriorhodopsin zur Protonen- und in Halorhodopsin zur Chloridtranslokation führt. Die Absorption der protonierten Schiffschen Base in Lösung ist in diesen Proteinen bathochrom verschoben. Ursachen sind die Ladungsumgebung im Protein und die spezifische Konformation des Retinals, die durch Wechselwirkung mit dem Protein entsteht. Im einzelnen tragen bei: a) Der Abstand zwischen einer negativen Ladung im Protein und dem positiv geladenen Stickstoffzentrum des Lysins 216 der protonierten Schiffschen Base, b) eine weitere negative Ladung oder ein Dipol oberhalb (unterhalb) des Cyclohexenringes und c) die Planarisierung von Ring und Kette an der C-6-C-7-Bindung (6-s-Bindung). Die sterische und elektronische Wechselwirkung des Retinals mit dem Proteinteil kann durch Einsatz von Retinal-Analoga und isosteren Verbindungen als Kontrolle analysiert werden. In dieser Hinsicht besonders interessant sind Substitutionen am Cyclohexenring, die den Torsionswinkel C5-C6-C7-C8 der 6-s-Bindung („6,7-Torsionswinkel“) beeinflussen können. Deshalb wurden 5-Methoxyretinal und 5-Ethylretinal synthetisiert und ihr Einfluß auf die Absorption der entsprechenden Bacteriorhodopsine untersucht.