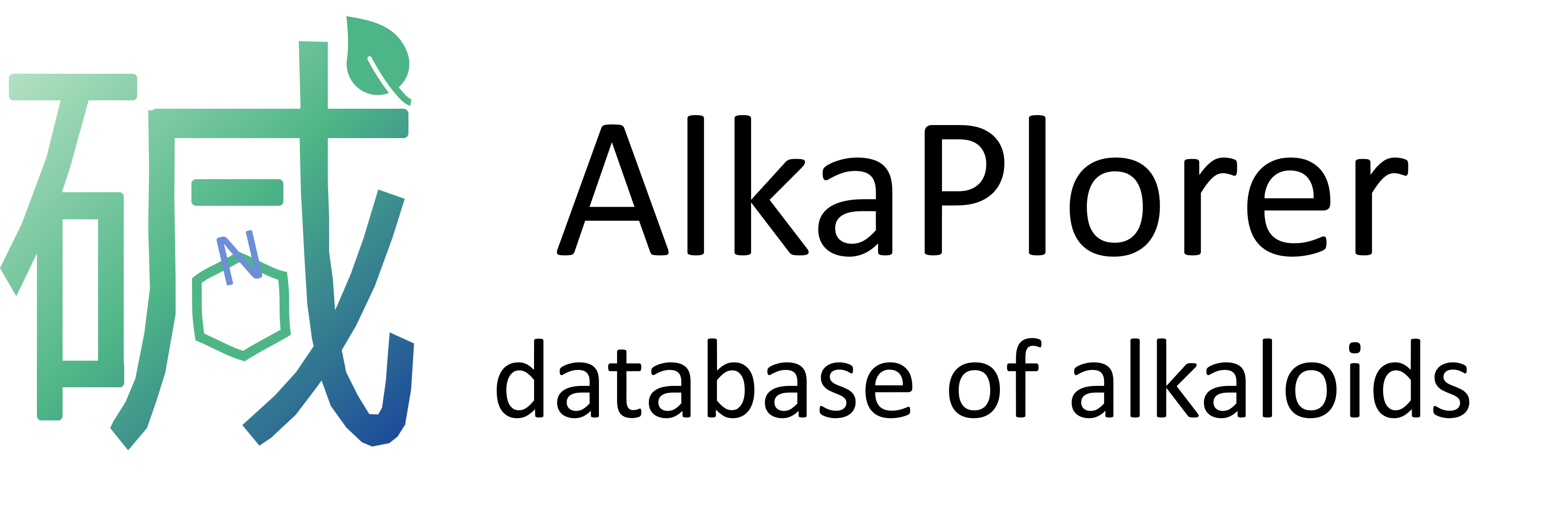
Lipophile Hefen der Gattung Malassezia (frher: Pityrosporum) gehren zur residenten Flora der menschlichen Haut und vieler Warmblter.[1] Derzeit werden sieben Spezies abgegrenzt, von denen M. furfur biochemische Besonderheiten aufweist. l-Tryptophan induziert als alleinige Stickstoffquelle in Kulturen dieser Spezies die Bildung einer Vielzahl von Indolalkaloiden, darunter zahlreiche Farb- und Fluoreszenzfarbstoffe.[2–4] Dies knnte bedeutsam fr die Pathogenese der Pityriasis versicolor (Kleienflechte) sein, einer mit schuppenden L4sionen einhergehenden Malasseziaassoziierten Hauterkrankung, die durch eine bislang ungekl4rte Farbvarianz und Fluoreszenz ihrer L4sionen gekennzeichnet ist.[5]Wir berichten ber die Isolierung von drei biologisch aktiven Bis(indolyl)spiranen aus Kulturen von M. furfur. Dazu wurde das Kulturmedium mit Essigester extrahiert und der Rohextrakt an Sephadex LH-20 vorfraktioniert. Die einzelnen Fraktionen wurden dnnschichtchromatographisch an Kieselgel aufgetrennt. Aus den erhaltenen Zonen ließen sich nach wiederholter HPLC die drei orangeroten Pityriarubine A–C (3, 6 und 7) sowie rotes Pityrianhydrid (1) und das unter UV-Licht gelb fluoreszierende Pityrialacton (2) rein gewinnen.1 wurde anhand seiner spektroskopischen Daten und durch direkten Vergleich mit einer authentischen Probe als 3,4-Bis(indol-3-yl)maleins4ureanhydrid identifiziert, eine Zwischenstufe der Arcyriarubin-A-Synthese,[6] die bisher nicht als Naturstoff bekannt war. 2 wurde von uns krzlich als ungewhnliches Bis(indolyl)oxobutenolid beschrieben.[7]Das optisch aktive Pityriarubin A (3) zeigt im ()-FAB-Massenspektrum einen Moleklpeak bei m/z 525, was fr die Summenformel C32H22N4O4 spricht. Im 1 H-NMR-Spektrum erkennt man außer den Arensignalen drei Signale im aliphatischen Bereich, die aus einem ABC-Spinsystem resultieren. Signale bei d = 2.92 und 3.26 ppm sind einer diastereotopen CH2-Gruppe zuzuordnen, Singuletts bei d = 9.16 (1H) und 9.99 ppm (2H) entsprechen drei stickstoffgebundenen Protonen aus Indolen. Im 13C-NMR-Spektrum treten zwei Signale bei d = 200.2 und 200.7 ppm fr die Carbonyl-C-Atome auf. Bei d = 174.3 ppm liegt das Signal eines Carboxy-C-Atoms, bei d = 62.7 ppm das Signal eines quart4ren C-Atoms. Daraus folgt fr Pityriarubin A die Spirostruktur 3, die mit allen spektroskopischen Daten im Einklang ist.Um die S-Konfiguration von 3 zu sichern, wurden die Spiroverbindungen 4 und 5 aus l-Tryptophan und den entsprechenden Triketonen synthetisiert. Beide Molekle haben wie 3 einen negativen Drehwert und stimmen im Verlauf der CD-Kurven sowie in ihren 13C-NMR-Daten gut mit 3 berein.[8]Die 1 H-NMR-Spektren der optisch inaktiven Pityriarubine B (6) und C (7) unterscheiden sich von dem von 3 durch fehlende Aliphatensignale. Im Arenbereich fallen zwei der drei Indol-Signals4tze zusammen, was fr eine symmetrische Struktur spricht. Auch die 13C-NMR-Daten von 6 und 7 sind gegenber denen von 3 vereinfacht. Aus den chemischenVerschiebungen und HMBC-Korrelationen ergibt sich, dass wie bei 3 eine 1,2-Bis(indol-3-yl)cyclopenten-3,5-dion-Einheit vorliegt, die am C4-Atom spiroartig mit einem 3- Hydroxypyrrolidin-2-on- bzw. einem 3-Hydroxyfuran-2-on-Ring verknpft ist. Daraus folgen fr die Pityriarubine B und C die Strukturen 6 bzw. 7.Die Strukturen der Malassezia-Metabolite lassen sich auf einfache Weise ableiten, wenn man das Triketon 8 als Vorstufe annimmt (Schema 1). Pictet-Spengler-Kondensationvon 8 mit l-Tryptophan wrde Pityriarubin A (3) liefern, w4hrend die Reaktion von 8 mit Indol-3-yl-brenztraubens4ureamid oder der entsprechenden Carbons4ure zu Pityriarubin B (6) bzw. C (7) fhren wrde. Hhnliche Reaktionen sind von Ninhydrin bekannt.[9] Auch Pityrianhydrid (1) und Pityrialacton (2) knnten aus 8 durch selektive oxidative Spaltung, gefolgt von oxidativer Decarboxylierung der resultierenden a-Ketos4ure und anschließendem Ringschluss entstehen.Um diesen Biosynthesevorschlag zu prfen, wurde d,l- [1'- 13C]Tryptophan an eine M. furfur-Kultur verfttert. Nach 14 Tagen wurden die Metabolite isoliert und der Einbaugrad 13C-NMR-spektroskopisch bestimmt. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, entsteht das Spiro-C-Atom der Pityriarubine aus der Carboxygruppe des Tryptophans, w4hrend die Carboxygruppe der zweiten Tryptophaneinheit verloren geht. Dies ist mit der Annahme des Triketons 8 als Zwischenstufe und dessen Bildung aus zwei Moleklen Indolylbrenztraubens4ure vereinbar. Iberraschenderweise zeigen die verschiedenen Metabolite große Unterschiede im 13C-Einbaugrad. Auch die jeweiligen Markierungspositionen weisen Differenzen auf, die sich bisher nicht erkl4ren lassen.Die Pityriarubine haben interessante biologische Wirkungen, die ihre nahe Verwandtschaft zu den als Proteinkinase-Inhibitoren wirksamen Bis(indolyl)maleinimiden[10] widerspiegeln. Beide Verbindungstypen unterdrcken konzentrationsabh4ngig den "Oxidativen Burst" von menschlichen Granulozyten im mm-Bereich, wobei die Wirkung der Pityriarubine mit der von Arcyriarubin A vergleichbar ist.[11] Im Hinblick auf den eingesetzten Stimulus sind die Pityriarubine jedoch signifikant selektiver. Der Angriffsort ist noch zu ermitteln. Unter der Annahme der Entstehung der Metabolite in vivo passen die entzndungshemmenden Eigenschaften der Pityriarubine zur klinisch bemerkenswert gering ausgepr4gten granulozyt4ren Reaktion in L4sionen der Pityriasis versicolor. [11] Iber die Isolierung und Strukturaufkl4rung weiterer Indolmetabolite aus M. furfur wird gesondert berichtet werden.